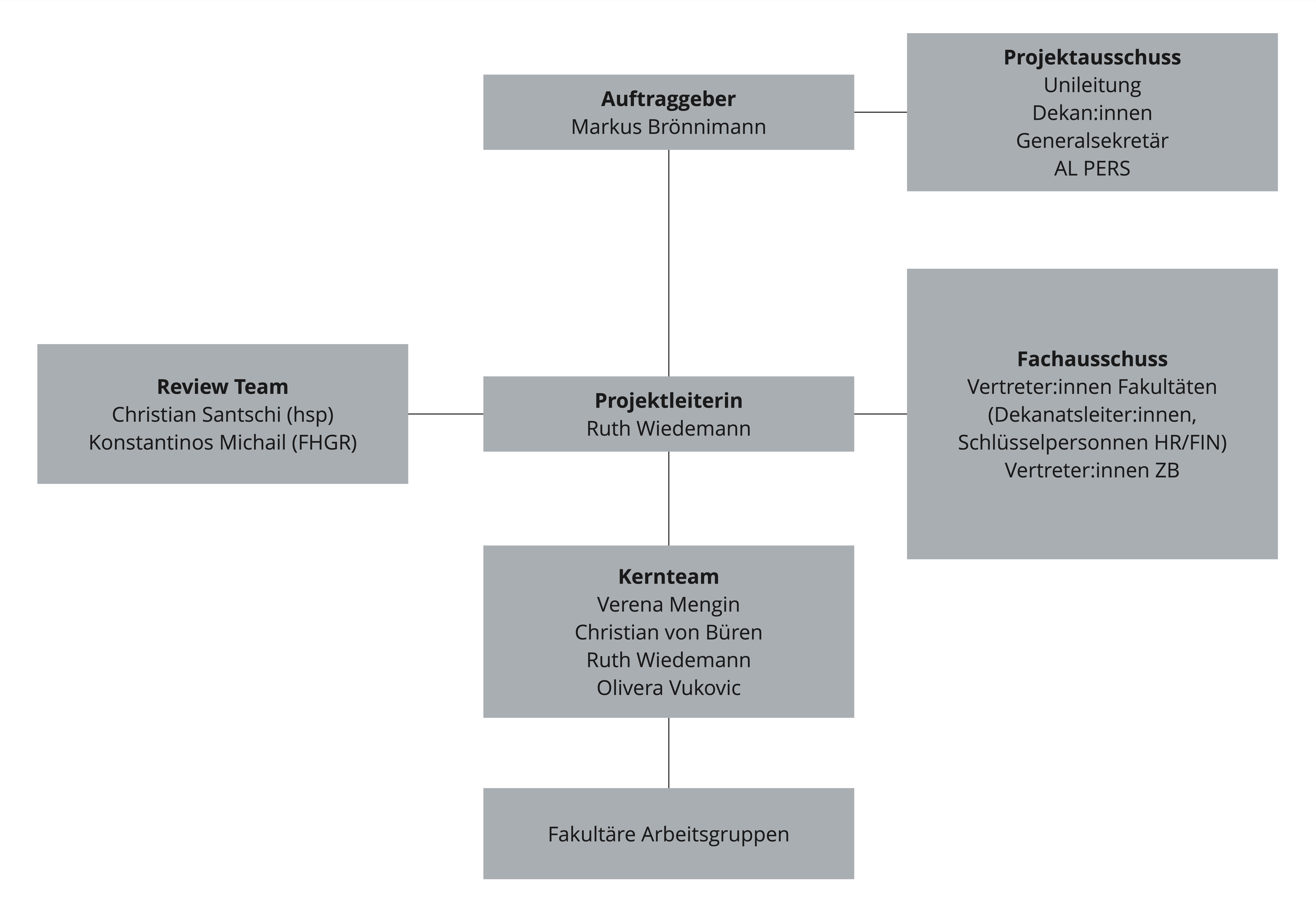Universitäre Strukturen: die 5 Projekte
Projekt A: Arbeitskreise
Ausgangslage
Die Einführung und Anpassung von Prozessen innerhalb der Universität erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den Fakultäten/Zentren und dem Zentralbereich, damit die Entscheidungsbefugnisse gleichwertig verteilt sind.
Ziele
Prozesse, Abläufe und Regelungen sollen sowohl aus der Sicht der Fakultäten als auch des Zentralbereichs effizient und effektiv gestaltet werden. Das Projektziel soll mit niederschwelligen, workshopartigen Arbeitsgruppen, in denen konkrete Problemstellungen und Lösungsansätze gemeinsam analysiert werden, erreicht werden.
Prozess/ Stand
Für die "Task Force Reiseplattform" wurden diverse Personen aus allen relevanten Zielgruppen eingeladen; die ersten beiden Veranstaltungen fanden im Mai 2025 (inkl. Kick-Off) statt, um Probleme im Buchungs- und Abrechnungsprozess zu identifizieren. Nach deren Durchführung und Evaluation wird in den Fakultäten der Bedarf weiterer fachspezifischer Arbeitskreise zu unterschiedlichen Themen geklärt. Die Arbeitsgruppen werden anschliessend aufgrund von funktionalen Prozessen oder organisationalen Zuständigkeiten zusammengestellt.
Stand: August 2025
Projekt B: Schnittstellenprojekt
Ausgangslage
Die Universität Bern ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen, hat an Komplexität gewonnen und steht zunehmend im Zeichen der digitalen Transformation. Daher ist eine zielgerichtete Weiterentwicklung der administrativen Strukturen notwendig. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Universität Bern auch künftig flexibel, effizient und leistungsfähig agieren kann.
Das Schnittstellenprojekt ist eines der Projekte aus dem Handlungsfeld “Universitäre Strukturen überdenken” des Programms „Fit for Future“. Ziel ist es, die Fakultäten von administrativen Aufgaben – insbesondere in den Bereichen Finanzen und Personal – zu entlasten, damit diese ihren Fokus auf die Kernaufgaben Lehre und Forschung legen können. Die administrativen Prozesse an der Universität Bern sind u.a. durch die Digitalisierung in ihrer Komplexität stark gewachsen. Die Analyse der bestehenden Prozesse hat ergeben, dass die Administration weiterentwickelt werden muss, um den künftigen Anforderungen und der geforderten Effizienz gerecht zu werden.
Massnahmen und Betroffene
Das Projekt B: Schnittstellenprojekt verfolgt folgende vier Massnahmen:
- Fakultäten werden in Departemente unterteilt: Fakultäten strukturieren sich in inhaltlich zusammengehörige Departemente und umfassen jeweils mindestens 10-15 Professuren/Dozenturen.
- In den Departementen werden administrative Aufgaben Personal & Finanzen gebündelt: Administrative Aufgaben, die heute dezentral bei Instituten und Einzelpersonen angesiedelt sind, werden in die Departemente verschoben.
- Den Fakultäten/Departementen stehen neu Partner:innen für Personal & Finanzen zur Verfügung: Diese unterstützen und beraten Führungskräfte und Mitarbeitende in besonders kniffligen Fällen. Sie sind in der VD angestellt.
-
Partizipatives Projektvorgehen: Mitarbeitende aus Fakultäten und Zentralbereich werden gemeinsam mit den jeweiligen Vorgesetzten ausgewählt und bringen ihr Wissen zu administrativen Aufgaben und Prozessen in die Arbeitsgruppen ein.
Primär betrifft das Projekt Mitarbeitende in den Sekretariaten der Fakultäten und des Zentralbereichs, die mit administrativen Aufgaben in den Bereichen Personal und Finanzen betraut sind. Aber auch Vorgesetzte und weitere Mitarbeitende können zukünftig betroffen sein, da sich durch das Schnittstellenprojekt Ansprechpersonen, Abläufe und Prozesse verändern werden.
Prozess/ Stand
Die Analyse und Einführung verschiedener Einheiten sollen in drei Wellen über die gesamte Universität bis ca. Ende 2027 durchgeführt werden. Das Kick-Off mit der Universitätsleitung und den Dekan:innen hat am 03.12.2024 stattgefunden.
Die Projektleitung hat zahlreiche Gespräche mit den Fakultäten geführt, in denen das Projekt, seine Ziele, der Aufbau sowie Rollen erläutert und offene Fragen geklärt wurden. Erste Präsentationen in Fakultätssitzungen haben stattgefunden und die gemeinsame Planung mit den ersten Fakultäten haben begonnen.
Die erste Welle des Projekts startete im Dezember 2024 mit dem Zentralbereich, der Phil.-nat. Fakultät (Start Juni 2025) und Phil.-hist. Fakultät (Start September 2025). Die Reihenfolge der Teilnahme der anderen Fakultäten ist noch nicht abschliessend entschieden. Die Planung erfolgt in Absprache mit den Dekan:innen. Insgesamt sind drei Wellen bis Ende 2027 geplant.
Im Zentralbereich wurde der Ablauf der Arbeitsschritte festgelegt, Einzelgespräche wurden geführt und die Ist-Analyse abgeschlossen. Im Sommer 2025 wurden Funktionendiagramme und Organisationsmodelle für den Zentralbereich entwickelt. Zur Verfeinerung der neuen Strukturen wurden Varianten der Organisationsstruktur, Stellenbeschriebe und die Auswirkungen auf die Abteilungen im Zentralbereich ausgearbeitet. Die Ergebnisse dienen als Diskussionsgrundlage in der Verwaltungsdirektion, den Vizerektoraten und der Universitätsleitung.
Im Herbst 2025 soll auch in den Fakultäten der ersten Welle mit der Analyse und diversen Interviews sowie anderen ersten Umsetzungsschritte begonnen werden.
Stand: August 2025
Die fünf Meilensteine im Schnittstellenprojekt
Meilenstein 1: Gemeinsames Verständnis schaffen
| Ziele |
|
| Angestrebtes Ergebnis |
|
| Projektbeteiligte |
|
Meilenstein 2: Entwicklung von Departementsstrukturen (durch die Fakultäten selber)
| Ziele |
|
| Angestrebtes Ergebnis |
|
| Projektbeteiligte |
|
Meilenstein 3: Analyse der bestehenden administrativen Abläufe und Prozesse
| Ziele |
|
| Angestrebtes Ergebnis |
|
| Projektbeteiligte |
|
Meilenstein 4: Konsolidierung der Ergebnisse und Gestaltung der neuen Arbeitsteilung
| Ziele |
|
| Angestrebtes Ergebnis |
|
| Projektbeteiligte |
|
Meilenstein 5: Neue Strukturen zum Leben erwecken
| Ziele |
|
| Angestrebtes Ergebnis |
|
| Projektbeteiligte |
|
Das Schnittstellenprojekt - Virginia Richter als Sponsorin
FAQs
Das Schnittstellenprojekt ist eines der Projekte aus dem Handlungsfeld “Universitäre Strukturen überdenken” des Programms „Fit for Future“. Ziel ist es, die Fakultäten von administrativen Aufgaben – insbesondere in den Bereichen Finanzen und Personal – zu entlasten, damit diese ihren Fokus auf die Kernaufgaben Lehre und Forschung legen können. Damit diese Entlastung erreicht werden kann, sind im Schnittstellenprojekt folgende vier Massnahmen definiert worden, zu welchen es FAQs gibt.
Massnahme 1: Departementsbildung
Die Fakultäten bilden Departemente mit mindestens 10-15 Professuren und Dozenturen, welche einen inhaltlich sinnvollen Bezug zu Lehre und Forschung haben. In Zukunft dienen die Departemente als Planungs- und Entwicklungseinheiten für die Fakultäten.
FAQ Departementsbildung
Massnahme 2: Aufgabenbündelung im Bereich Personal und Finanzen
Durch eine gezielte Aufgabenbündelung wird die Effizienz der administrativen Prozesse gesteigert, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten klar definiert.
FAQ Aufgabenbündelung im Bereich Personal und Finanzen
Massnahme 3: Partner Modell
Für die Bereiche Personal und Finanzen ist die Einführung eines sogenannten “Partner-Modells” vorgesehen. Die Partner:innen im Bereich Personal und Finanzen werden Mitarbeitende und Führungskräfte vor Ort beraten und unterstützen. Die Stellenprofile für diese Partner:innen werden im Rahmen des Schnittstellenprojekt erstellt und auf die Bedürfnisse in den Fakultäten und dem Zentralbereich ausgerichtet.
FAQ Partner Modell
Massnahme 4: Partizipation im Projekt
Das Schnittstellenprojekt wird partizipativ gestaltet. In den Fakultäten und dem Zentralbereich werden gemeinsam mit den Vorgesetzten aus den betroffenen Organisationseinheiten Teilnehmende für die Arbeitsgruppen ausgewählt. Diese Teilnehmenden, auch Mitgestalter:innen genannt, bringen ihr Wissen zu den administrativen Prozessen und Abläufen ein. Primär betrifft das Projekt Mitarbeitende in den Sekretariaten der Fakultäten und des Zentralbereichs, die mit administrativen Aufgaben in den Bereichen Personal und Finanzen betraut sind. Aber auch Vorgesetzte und weitere Mitarbeitende können zukünftig betroffen sein, da sich durch das Schnittstellenprojekt Ansprechpersonen und Prozesse verändern werden.
FAQ Partizipation im Projekt
Projekt C: Professurenplanung neu
Ausgangslage
Gemäss der universitären Strategie 2030 soll gewährleistet werden, dass der Status als Volluniversität beibehalten und gleichzeitig eine thematische Weiterentwicklung in den Fachbereichen ermöglicht wird. Dem steht die finanzielle Situation der Universität Bern im Weg. Professuren sind der Treiber von Ertrag und Aufwand, von Inhalt und Struktur – von Akademie.
Ziele
Um handlungsfähig zu bleiben, soll die Professurenplanung dynamischer werden und die Fortschreibung des IST-Zustandes bei Emeritierungen ersetzen.
Prozess/ Stand
Die Projektorganisation ist definiert und eine externe Projektunterstützung beauftragt. Die Projektbeteiligten stehen in regem Austausch mit der Leitung des Schnittstellenprojektes. Aktuell wird das Projekt konzeptionell vorangetrieben, es wurden erste Skizzen des Zielbildes, Schätzungen des Mengengerüsts sowie ein provisorischer Zeitplan inkl. Termine und Meilensteine erarbeitet. In den nächsten Monaten werden das Konzept, die Ziele sowie Detailregelungen und Prozesse weiterentwickelt.
Stand: August 2025
Projekt D: Stärkung der Studiengangsleitungen
Ausgangslage
Um ihrem Anspruch auf ausgezeichnete Lehre gerecht zu werden, steht die Universität vor Entwicklungsbedarf im Hinblick auf Herausforderungen wie Digitalisierung, K.I., oder Internationalisierung. Die Supportstellen rund um die Lehre bieten Unterstützung an, stellen aber immer wieder fest, dass Informationen nicht nahtlos bei der Zielgruppe ankommen. Auch fehlt ein Feedback-System und es gibt Potenzial bei der Koordination der Prozessen im Rahmen der Studienprogramme.
Ziele/ Ergebnisse
Das Projekt "Stärkung der Studiengangsleitungen" hat ein erstes Informations- und Kontaktnetz zwischen dem VRL und den Fakultäten geschaffen. In einem nächsten Schritt werden Bedarfsanalysen mit Hilfe von Interviews vorgenommen. Diese und weitere Massnahmen wurden in die Aufgabenportfolios der Supportstellen integriert und werden nicht mehr als Projekt unter dem Dach Fit for Future weitergeführt. Informationen zu Ergebnissen aus den Bedarfsanalysen und daraus abgeleitete Massnahmen werden nach Abschluss der Vorhaben bei den Projektinformationen zu finden sein (z.B. EASE: Educational Academic Staff Empowerment).
Das Projekt kann im Rahmen von F4F als abgeschlossen betrachtet werden (Frühjahr 2025).
Projekt E: Vertrag Zentren
Ausgangslage
Die 10 strategischen Zentren der Universität Bern sind sehr heterogen und bei ihrer Führung wird Entwicklungspotential gesehen.
Ziele
Zwischen Zentrum, beteiligten Fakultäten und Universitätsleitung sollen «Kooperationsverträge» aufgesetzt werden, die klar von bestehenden Instrumenten wie Leistungsauftrag sowie Rahmen- und Geschäftsordnung abgrenzbar sind.
Prozess/ Stand
Durch Bedarfs- und Erfahrungshebungen sowie einer detaillierten Zielklärung wird die konzeptionelle Basis für die Verträge geschaffen. Im Konzept soll zudem die Effektivität bestehender Prozesse sowie der Mehraufwand im Verhältnis zum Mehrwert von möglichen Vorgehensvarianten abgeschätzt werden.
Nach diversen Gesprächen im Zentralbereich ist nun ein Vorgehensplan inklusive Übersicht über die verschiedenen Projektetappen in Arbeit.
Stand: August 2025